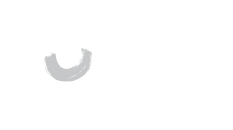Mit freundlicher Genehmigung durch Britt Schlehahn und LVZ-Sportbuzzer
Sebastian Kirschner ist beim Fanprojekt Leipzig seit 2013 für die BSG Chemie zuständig. Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER erzählt er über seine Aufgaben im Ligaalltag, die manchmal schwierige „Übersetzerfunktion“, seine Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie und das „Raumschiff Fußball“.
Was macht das Fanprojekt Leipzig eigentlich?
Sebastian Kirschner: Fanprojekte sind nicht, wie viele immer denken, bei den Vereinen angesiedelt sondern unabhängige, mit öffentlichen Mitteln finanzierte Institutionen der Jugendhilfe. Im ganzen Land gibt es mehr als sechzig, in Leipzig „kümmert“ sich das Fanprojekt, das unter der Trägerschaft von Outlaw (Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH, d. Red.) steht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, um die Fanpotentiale der drei großen Vereine RB, Chemie und Lok.
Jeder Verein hat sozialpädagogische Mitarbeiter, die nur für die jeweilige Klientel da sind. Unsere Zielgruppe sind daher vor allem Kinder und Jugendliche. Und um es noch präziser zu machen, in erster Linie junge Leute, die sich der Jugend- und Subkultur der „Ultras“ zuzählen. Ultras kommen ursprünglich aus Italien und sind derzeit eine der größten und vitalsten Jugendkulturen der Welt.
Seit 2013 bin ich für die Chemiefans also „da“ und habe den Weg des Vereins und seine Anhängerschaft von der Bezirksliga bis in die 4. Liga miterlebt. Unser Arbeitsalltag ist extrem vielfältig und dreht sich vor allem darum, jungen Fans, trotz aller Schwierig und -widrigkeiten eine positive Lebensorientierung mitzugeben. Natürlich thematisieren wir auch problematische Entwicklungen in der Fankultur, viel wichtiger und entscheidender sind aber die Momente von Selbst- und Mitbestimmung, gesellschaftlicher Verantwortung und kreativer Mitgestaltung: alles Dinge, die das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Fußballfans ganz zentral ausmachen.
Ein gegenseitiges belastbares Vertrauensverhältnis, die Freiwilligkeit der Interaktion und eine gewisse Intensität der „Zusammenarbeit“ sind dabei ebenso wichtig, wie ein Verständnis von „Jugend“ auf der Höhe der Zeit. Die Schwierigkeiten, die der Lebensabschnitt Jugend mit sich bringt, bearbeiten wir in Einzelfallhilfen und Beratungsangeboten. Tiefgreifende aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen spiegeln sich natürlich auch in der Fankultur wieder – oftmals sogar viel deutlicher: Fanprojekte unterstützen hier das eh schon große Potential an politischem „Teilhabenwollen“, sie forcieren historische Bildungsarbeit oder flankieren Entwicklungen, die zu Geschlechter- oder Chancengleichheit führen sollen.
Was war bisher Ihr schönstes und schlimmstes Erlebnis bei der BSG?
Schönste Momente sind meistens fußball-immanente Überraschungen: Siege, die man nicht erwartet hätte, besondere Tore, die Glücksgefühle auslösen und natürlich hochemotionale Aufstiege und Pokalspiele. Als Sozialarbeiter ist man da ganz schön nah an der Gefühlswelt der Fans dran. Und trotz professionellem Verhältnis überkommt einen dann doch mal der irrationale Fußballwahnsinn. Ein Gefühl, das ich vorher so nicht kannte. Schlimm ist eigentlich nichts. Man lernt, sich – zumindest in manchen Situationen – ein dickes Fell zuzulegen. Das braucht man auch und ist Bestandteil des Alltags.
Wie ist das Verhältnis zum Verein?
Sehr gut. Das basisdemokratische Verständnis in den Vereinsstrukturen – der Verein wurde ja von seinen Fans mit jeder Menge Herzblut wieder gegründet – spiegelt sich natürlich auch in der Zusammenarbeit wieder. Viele kurze Wege mit dem Fan- und Sicherheitsbeauftragten der BSG, intensive Kommunikation, ein großes Verständnis und eine fundierte Kenntnis über das „Denken und Fühlen“ von Fans: all das kennzeichnet unser Arbeitsverhältnis. Und selbst wenn es mal zu divergierenden Positionen kommt – was recht selten der Fall ist – sind wir in der Lage, diese produktiv und mit Anerkenntnis für die jeweils andere Meinung zu lösen.
Welche Rolle spielt der Fanbeauftragte im normalen Ligaalltag?
Eine vielfältige, würde ich sagen. In erster Linie geht es dabei um präventive Kommunikation. Es gibt an jedem Spieltag viele „Player“ mit teilweise unterschiedlichen, manchmal auch entgegenstehenden Interessen. Natürlich stehen die Fans an erster Stelle, wobei mein vorrangiger Arbeitsauftrag „jungen Fans“, vor allem Ultras und Ultra‘-nahen Gruppen gilt. Dann gibt es den Heim- und Gastverein, die Fan- und Sicherheitsbeauftragten. Also die, die sich innerhalb der Vereinsstrukturen bewegen. Es gibt die Fußballverbände und deren Mitarbeiter, die oftmals ein ganz eigenes Verständnis von der Bewältigung von Fußballspielen haben.
Und es gibt die ordnungs- und sicherheitspolitische Seite: kommunale Ämter, Rettungsdienste, Security und natürliche die verschiedenen polizeilichen Organisationsteile – Bundes- und Landespolizei, das Revier um die Ecke, die szenekundigen Beamten. Deren Blick auf den Fußball unterscheidet sich dahingehend von unserem, dass er natürlich ein ausschließlich sicherheitspolitischer ist. In Sicherheitsbesprechungen, die in der Regel vor jedem Spiel stattfinden, aber auch in vielen bilateralen Gesprächen versuchen Fanprojekte die Perspektive von organisierten Fans zu verdeutlichen. Oftmals üben wir dabei eine Art „Übersetzerfunktion“ aus, wir sind quasi der institutionalisierte Dialog und sensibilisieren die „Erwachseneninstitutionen“ für jugendliches Fan-Sein und deren Bedürfnisse. Das ist meistens herausfordernd, manchmal auch anstrengend, weil die unterschiedlichen „Denksysteme“ oftmals nicht kongruent sind.
Wie hat die Pandemie die Arbeit verändert? Wie sieht der gegenwärtige Arbeitsalltag aus?
Natürlich hat Covid-19 wie alle gesellschaftlichen Bereiche auch den Fußball durcheinander gewirbelt. Soziale Arbeit mit Fußballfans in Zeiten, in denen vermutlich langfristig kein Fußball gespielt, oder zumindest live gesehen wird, das klingt absurd. Zumal der direkte Draht zu den Fans, das vertraute Gespräch oder die intensive Diskussion rund um die Spieltage eben nicht stattfinden können. Auch Fußball-immanente Konflikte sind gerade kaum vorhanden. Und klassisches Streetwork funktioniert im Homeoffice auch nur bedingt: Digitalisierungshype hin oder her. Auch unsere Räumlichkeiten können wir nicht nutzen, physische Distanzierung macht soziale Interaktion insgesamt schwer, auch zwischen den Fans untereinander.
Wir versuchen daher das Beste draus zu machen und bleiben eigentlich bei unseren Kernthemen: Kommunikation ist zentral und wird mit Abstand oder eben digital geführt. Den erhöhten Beratungsbedarf z.B. zur individuellen Existenzsicherung merken wir natürlich. Und selbstverständlich tauschen wir uns zur „Lage der Welt“ aus, teilen die Sorgen und fragen uns gemeinsam, wie und wann so etwas wie „Normalität“ wieder stattfinden kann. In den Fanszenen existiert ein sehr feines Gespür, wenn es um die Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten und Grundrechten geht. Umso interessanter und emanzipierter ist zum Beispiel der Forderung der Ultras von Chemie zu bewerten, angesichts der Pandemie und der damit verbundenen sozialen Verantwortung den Spielbetrieb auszusetzen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbände sich noch fest an den Spielbetrieb klammerten.
Aktuell organisiert ein großes und stadtübergreifendes Netzwerk rund um die chemische Fanhilfe Unterstützungsangebote wie Einkauf, Kinderbetreuung und Alltagshilfe für Menschen mit Bedarf. Das ist beeindruckend und freut uns natürlich. Wir brauchen da Dank der guten Selbstorganisation gar nicht viel machen und vermitteln maximal den Kontakt zum Gesundheitsamt oder zu professionellen Selbsthilfeorganisationen.
Welche Wünsche gibt es für die Zukunft?
Definitiv spielt Fußball gerade eine untergeordnete Rolle, und das ist auch gut so. Meine beruflichen Wünsche daher in Worte zu fassen fällt mir angesichts der aktuellen Unübersichtlichkeit schwer. Irgendwann wäre eine Rückkehr zum Fußball mit Zuschauern natürlich schön und wichtig fürs Gemüt. Fankultur wird nach Corona sicher nicht mehr so sein wie zuvor. Im Moment zählt aber definitiv etwas anderes. Spannend empfinde ich die Debatte, die sich aktuell um das „Raumschiff Fußball“ in Zeiten der Pandemie dreht – Stichwort eigene Privilegien, ökonomische Selbstreflektion oder gesellschaftliche Solidarität. Hier haben beispielweise die meisten Ultras gegenüber dem Gros an Fußball-Funktionsträgern einen moralischen Vorsprung, der sich kaum bemessen lässt. Interessant, wer sich am Ende durchsetzt.